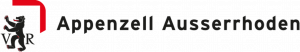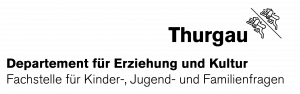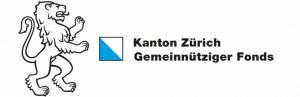Was passiert, wenn das Gesetz die Familie vereinheitlichen will?
Mit der Parlamentarischen Initiative «21.449 | Förderung der alternierenden Obhut» soll die gemeinsame Betreuung von Kindern nach einer Trennung der Eltern gesetzlich stärker verankert werden. Ziel ist es, die Verantwortung beider Elternteile zu fördern und die Beziehung des Kindes zu ihnen zu sichern. Ein Bestreben, welches wir von der Ombudsstelle Kinderrechte Schweiz im Grundsatz anerkennen und unterstützen. Gleichzeitig sehen wir erhebliche Bedenken in der gesetzlichen Umsetzung und lehnen darum die beiden vorgeschlagenen Gesetzesänderungen ab: Kinder brauchen keine Einheitslösungen – sie brauchen Mitbestimmung, Stabilität und individuell passende Modelle.
Kinder und Jugendliche leben heutzutage in einer Vielfalt an Lebens- und Familienformen. Dies betrifft sowohl Familien, die unter einem Dach leben, als auch getrennte Eltern, die ihre Verantwortung gemeinsam wahrnehmen. Aus kinderrechtlicher Perspektive ist zu betonen, dass Kinder grundsätzlich ein Recht darauf haben, von beiden Elternteilen betreut, gefördert und begleitet zu werden – unabhängig davon, ob die Eltern zusammenleben oder getrennt sind. Eine enge Beziehung zu beiden Elternteilen trägt wesentlich zur emotionalen Sicherheit, Stabilität und gesunden Entwicklung von Kindern bei. Deshalb ist es wichtig, Strukturen zu schaffen, die diese gemeinsame elterliche Verantwortung unterstützen und es Kindern ermöglichen, mit Mutter und Vater in engem Kontakt zu bleiben sowie eine ausgewogene Bindung zu beiden zu pflegen.
Vorgeschlagene Gesetzesänderung wird individuellen Bedürfnissen nicht gerecht
Die Idee, diese Strukturen mit den vorgeschlagenen Änderungen im Zivilgesetzbuch zu erreichen, greift aus unserer Sicht zu kurz. Die Änderungen sind zu starr, berücksichtigen die Vielfalt der Familienmodelle zu wenig und werden den individuellen Bedürfnissen der Kinder nicht gerecht. Es ist eine grosse Herausforderung, den Familienalltag nach einer Trennung so zu organisieren, dass er das Wohl der Kinder in den Mittelpunkt stellt und ihnen so viel Stabilität und Verlässlichkeit wie möglich gibt. Darum ist es entscheidend, dass jede Familie die Möglichkeit hat, individuell zu bestimmen, was für ihre Situation am besten passt: sei es bei den Betreuungsformen, der Rollenaufteilung oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Bedürfnisse der Kinder sind zentral
Es muss dabei auch berücksichtigt werden, dass Kinder und Jugendliche je nach Alter und Umständen sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Die alternierende Obhut ist daher nicht das eine Modell, das für alle, und insbesondere nicht für alle Kinder, ideal ist. Dies erleben wir auch in unserem Praxis-Alltag immer wieder. Bei Fragen der Obhut braucht es deshalb passgenaue Lösungen, die den Bedürfnissen aller Beteiligten gerecht werden und das Wohl der Kinder in den Mittelpunkt stellen. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die Eltern sich nicht einigen können und mit Hilfe des Gerichts eine Lösung gefunden werden muss.
Äussere Rahmenbedingungen erschweren alternierende Obhut
Die Gründe, warum sich Familien gegen eine alternierende Obhut entscheiden, liegen häufig nicht in elterlichen Konflikten, sondern in äusseren Rahmenbedingungen. Dazu zählen insbesondere die finanzielle Situation der Eltern, ihre organisatorischen Möglichkeiten oder auch die räumliche Distanz zwischen den Wohnorten. Diese Faktoren können eine gleichwertige Betreuung erschweren oder gar unmöglich machen. Wichtig zu bedenken ist in diesem Zusammenhang auch, dass viele Familien im Alltag die Betreuung anders leben als ursprünglich vereinbart. Eine reine Anordnung der alternierenden Obhut bedeutet also nicht, dass dieses Modell für die Familien im Alltag dann auch wirklich funktioniert.
Anregungen und Optimierungsvorschläge
Wir von der Ombudsstelle Kinderrechte Schweiz unterstützen keine der beiden vorgeschlagenen Varianten zur Gesetzesänderung zur Förderung der alternierenden Obhut. Stattdessen soll das übergeordnete Kindesinteresse bei Sorgerechts- und Obhutsfragen konsequent in den Mittelpunkt gestellt, die Partizipation der Kinder gestärkt und die individuellen Familiensituationen sorgfältig geprüft werden.
Folgende Punkte gilt es aus unserer Sicht zu berücksichtigen:
Fokus auf das übergeordnete Kindesinteresse
Entscheidend darf nicht ein bestimmtes Betreuungsmodell sein, sondern ausschliesslich das, was für das individuelle Kind am besten ist. In diesem Zusammenhang sprechen wird uns für die Verwendung des Begriffs «übergeordnetes Kindesinteresses» statt «Kindeswohl» aus – im Einklang mit der UNO-Kinderrechtskonvention.
Stärkung der Kindespartizipation und -information
Kinder müssen ihr Recht auf Mitbestimmung bei Entscheidungen, die sie betreffen, kennen und wahrnehmen können. Sie brauchen neutrale Fachpersonen, die sie altersgerecht informieren und begleiten. Diese Anhörung muss auch dann sichergestellt sein, wenn sich die Eltern einvernehmlich einigen.
Gleichbehandlung aller Familienmodelle
Das Gesetz darf kein Betreuungsmodell bevorzugen. Entscheidend muss die individuelle Passung für die spezifische Familiensituation, die Ressourcen der Eltern und die Bedürfnisse des Kindes sein.
Ablehnung einer starren 50/50-Regelung
Eine gesetzlich festgelegte Betreuung zu gleichen Teilen ist nicht kindgerecht und widerspricht der Vielfalt familiärer Realitäten. Starre Quoten können den unterschiedlichen Bedürfnissen von Kindern, die je nach Alter und Entwicklungsstand stark variieren können, nicht Rechnung tragen.
Klärung der Begrifflichkeit
Der Ausdruck «alternierende Obhut» ist missverständlich und suggeriert oft eine hälftige Aufteilung. Treffender wäre der Begriff «gemeinsame Betreuungsverantwortung», da dieser die gemeinsame Verantwortung der Eltern in den Mittelpunkt stellt, unabhängig von der prozentualen Aufteilung.
Qualität der Prüfung und Entscheidungsfindung
Entscheidungen müssen anhand klar definierter Kriterien und durch gut geschulte Fachpersonen erfolgen. Die Einrichtung von spezialisierten Familiengerichten könnte massgeblich zur Qualitätssicherung bei Obhutsfragen beitragen.
Beratung und Unterstützung der Familien
Eltern sollen frühzeitig Begleitung und Mediation erhalten, um tragfähige, kindgerechte und nachhaltige Lösungen zu finden. Fachliche Unterstützung kann helfen, das Wohl des Kindes im Blick zu behalten und Eltern darin zu stärken, ihre Verantwortung partnerschaftlich und verlässlich wahrzunehmen.
Trennung von Betreuungs- und Unterhaltsfragen
Die Wahl des Betreuungsmodells darf nicht von finanziellen Überlegungen bestimmt werden. Das übergeordnete Kindesinteresse muss stets Vorrang haben.
Wir haben im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur «Parlamentarischen Initiative 21.449 | Förderung der alternierenden Obhut» eine ausführliche Stellungnahme verfasst, die hier eingesehen werden kann: